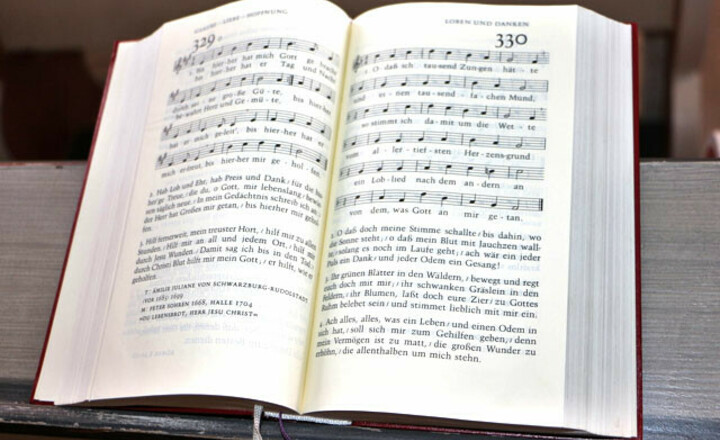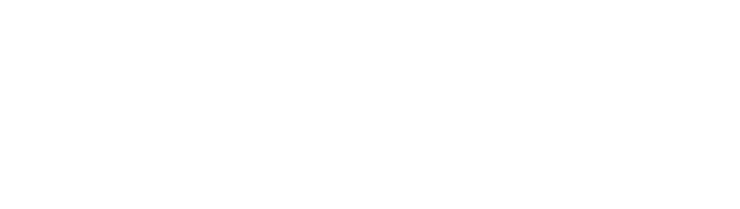Predigt von Pfarrer Daigeler zum 30. Sonntag im Jahreskreis C
Download Audiodatei der Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, in diesen Tagen halten wir in den Kirchen unseres pastoralen Raums Schweinfurter Oberland die „Ewige Anbetung“. Die Bedeutung dieser Gebetsform hat sich vielerorts verändert. Früher war das oft eine Art Ortsfeiertag, an dem die Arbeit unterbrochen wurde. Heute ist es meist eine kleine Schar von treuen Betern, die sich vor dem ausgesetzten Allerheiligsten einfindet.
Gewiss hat das unterschiedliche Gründe: Viel weniger Menschen als in früheren Zeiten arbeiten noch vor Ort. Und die Teilnahme am gottesdienstlichen Leben ist insgesamt in den letzten Jahren zurückgegangen. Das wird man bei nüchterner Betrachtung erkennen. Aber ich meine, dass diese Form der „Ewigen Anbetung“ eine tiefere Herausforderung oder Anfrage an unsere Spiritualität darstellt.
Unsere Epoche ist von Wirtschaftlichkeit und Effizienz geprägt. Das beeinflusst verbunden mit einem gewachsenen Individualismus auch unser Glaubensleben. „Wenn ich in die Kirche gehe, dann will ich etwas mitnehmen“, diesen Satz habe ich mehrfach gehört. Und er ist ja nicht falsch. Natürlich kommen wir in der Sonntagsmesse zusammen, um Stärkung für unseren Weg zu empfangen, indem wir Gottes Wort hören und die Gegenwart Christi in der Eucharistie feiern. Darum sind wir manchmal enttäuscht, wenn der Gottesdienst nicht unseren Erwartungen entspricht, wenn die Lieder oder die Verkündigung uns nicht ansprechen, wenn etwas unverständlich war, wenn wir keine Brücke zu unseren Fragen entdecken können…
Wie gesagt, das ist verständlich. Und doch geht unser Beten und gottesdienstliches Feiern darüber hinaus. Jesus erzählt im Evangelium ein Gleichnis, in dem es um das Gebet geht. Vielleicht ist es manchem bekannt. Jedenfalls haben wohl viele bestimmte Vorstellungen, wenn sie die Worte „Pharisäer“ oder „Zöllner“ hören. Vermutlich sind unsere Assoziationen genau umgekehrt wie bei den Zuhörern Jesu. Wir halten vielleicht Pharisäer für Heuchler und Zöllner für gute Menschen. Für das Umfeld Jesu waren Pharisäer Menschen, die besonders intensiv bemüht waren, den jüdischen Glauben zu leben. Und Zöllner waren Kollaborateure mit der Besatzungsmacht Rom, die sich meist auf Kosten der Steuerzahler bereicherten. Jesus provoziert also. Er fordert heraus, um deutlicher zu machen, worum es ihm geht.
Doch worum geht es ihm? Für Jesus ist das Gebet weniger eine Abfolge von bestimmten Worten als eine innere Haltung. An anderer Stelle mahnt er seine Jünger: „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden…“ Natürlich verwirft Jesus nicht formulierte Gebete. Er weiß, dass seine Jünger sie brauchen und lehrt sie darum das Vaterunser. Aber damit unser Beten erhört wird, braucht es Demut. „Das Gebet des Demütigen durchdringt die Wolken“, hörten wir in der Ersten Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Und in ähnlichen Worten spricht der Zöllner im Tempel: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“
Beten beginnt mit der Haltung, dass wir vor Gott keine Ansprüche erheben können. Dass wir leben, dass wir so viel Gutes haben, dass wir den Erlöser Jesus Christus kennen, all das sind nicht unsere Verdienste. Es ist Gottes Geschenke. Es ist seine Gnade. Darum beginnt das eigentliche Gebet mit der Haltung der Dankbarkeit. Wenn die Kirche Gebete formuliert, spricht sie aus, was Gott bereits getan hat, und preist ihn dafür. Und in dieser demütigen Haltung wächst die Gewissheit, dass er auch heute ebenso handeln wird.
Was hat das nun mit der „Ewigen Anbetung“ zu tun? Sie verfolgt keinen bestimmten Zweck, dass wir hierfür oder dafür beten würden. Vielleicht ist sie darum heute schwer verständlich. Wir reihen uns ein in eine Gebetskette der Dankbarkeit. Die Zeit, die wir vor der heiligen Eucharistie in der Monstranz verbringen, geschieht in der Haltung, dass er mich sieht und versteht. Seine Liebe wartet auf meine Antwort. Je mehr ich verstehe, wie er mich liebt und trägt, desto weniger Worte braucht es und desto fruchtbarer wird mein Beten. Amen.
26.10.2025, Pfarrer Dr. Eugen Daigeler